
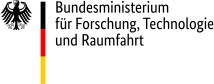
Die Bundesregierung setzt gezielt auf den Ausbau leistungsfähiger Recheninfrastruktur, um Deutschland als führende KI-Nation zu positionieren. Ein zentrales Ziel dieser Strategie ist der Ausbau Deutschlands zum europäischen Leuchtturm für Rechenzentren. Damit soll auch der benötigte Zugang zu Supercomputern für die Forschung gesichert werden.

Seit 2023 durchläuft die Ausstattung der Rechenzentren einen tiefgreifenden Wandel: Der Fokus verlagert sich von klassischen numerischen Simulationen hin zu KI-Anwendungen. Das Training von KI-Modellen stellt neue Anforderungen – es erfordert weniger Rechengenauigkeit, dafür aber deutlich mehr Rechenoperationen pro Sekunde. Für Rechenzentren bedeutet das einen starken Bedarf an hochleistungsfähigen GPUs (Grafikprozessoren) und spezialisierten KI-Beschleunigern. Ziel ist der Aufbau maßgeschneiderter KI-Infrastrukturen, die optimal auf die Anforderungen von KI-Training abgestimmt sind.
In Deutschland entstehen bereits zwei spezialisierte „AI-Factories“, die der Industrie direkten Zugriff auf KI-Trainingsinfrastruktur ermöglichen. Zusätzlich haben aus Deutschland mehrere Industriekonsortien ihr Interesse bekundet, gemeinsam mit der Europäischen Kommission eine „AI-Gigafactory“ mit bis zu 100.000 GPUs aufzubauen. Diese Mega-Infrastruktur kombiniert enorme Rechenleistung mit integrierten Datenplattformen und hoher Automatisierung – ein entscheidender Schritt für eine wettbewerbsfähige KI „Made in Europe“.
Ein Meilenstein auf dem Weg dieses tiefgreifenden Wandels ist die Inbetriebnahme des Exascale-Supercomputers JUPITER am Forschungszentrum Jülich. Mit rund 24.000 spezialisierten GPUs gehört JUPITER zu den weltweit schnellsten KI-Systemen und treibt zugleich die wissenschaftliche Spitzenforschung voran. Das Projekt wird vom Forschungszentrum Jülich und dem Gauss Centre for Supercomputing (GCS) getragen, das die drei nationalen Spitzenrechenzentren in Jülich, Garching und Stuttgart vereint.

JUPITER wird mit 250 Millionen Euro von der europäischen Supercomputing-Initiative EuroHPC JU und mit je 125 Millionen Euro vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sowie dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW NRW) finanziert.
Mit dieser Infrastruktur schafft Deutschland eine HPC-Landschaft von Weltrang – ein Vorbild für Europas digitale Zukunft.
Die Nutzer der HPC-Infrastruktur sind vielfältig: Von kleinen universitären Forschungsgruppen bis zu groß angelegten Klimasimulationen, die europaweit vernetzt sind. Rechenzentren lassen sich flexibel skalieren und passen sich so an verschiedene Anforderungen an. Um Orientierung zu schaffen, ist die deutsche HPC-Infrastruktur als Pyramide mit vier Ebenen strukturiert (Stand der Leistungsdaten: November 2024):
Ebene 3 bildet die Basis: regionale Universitätsrechencluster, die vor allem kleine bis mittlere Berechnungen unterstützen. Nutzer sind Studierende und Forschende an Hochschulen, die einfache Zugänge und moderate Rechenkapazitäten benötigen.
Leistungsdaten aller öffentlichen deutschen Systeme: https://gauss-allianz.de/de/hpc-ecosystem
Ebene 2 besteht aus überregionalen HPC-Zentren. Derzeit gibt es neun dieser Zentren, die im Verbund „Nationales Hochleistungsrechnen“ (NHR) zusammenarbeiten. Sie bieten leistungsfähige Infrastruktur für komplexe wissenschaftliche Anwendungen und ermöglichen eine bundesweit koordinierte Nutzung.
Leistungsdaten der Ebene 2:
Zur Website Nationales Hochleistungsrechnen
Ebene 1 bildet die Spitze: die drei leistungsstärksten Rechenzentren im Gauss Centre for Supercomputing (GCS) in Jülich, Garching und Stuttgart. Diese Zentren verfügen über spezialisierte Architekturen und bieten enorme Rechenleistung sowie große Speicherkapazitäten für anspruchsvolle Nutzer. Sie sind eng vernetzt und werden paritätisch von Bund und Ländern finanziert.
Leistungsdaten der Ebene 1:
Ebene 0 steht über der nationalen Pyramide: europäische HPC-Infrastruktur, organisiert durch das gemeinsame Unternehmen EuroHPC JU, eine Partnerschaft der EU-Kommission mit 32 Staaten und Industrieverbänden. Hier wurde mit JUPITER der erste europäische Exascale-Supercomputer in Deutschland in Betrieb genommen. Zudem sind auf europäischer Ebene AI Factories und zukünftig AI Gigafactories geplant, die Unternehmen gezielten Zugang zu KI-HPC-Ressourcen bieten.
Leistungsdaten der Ebene O: